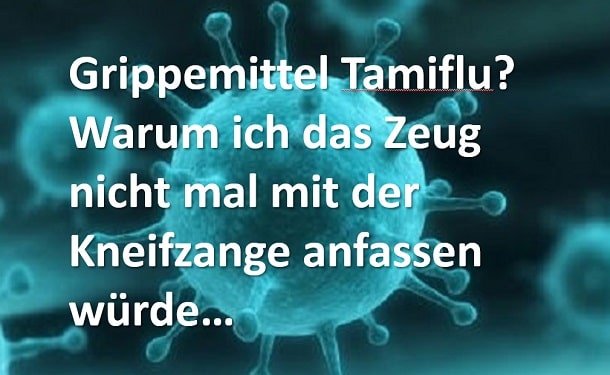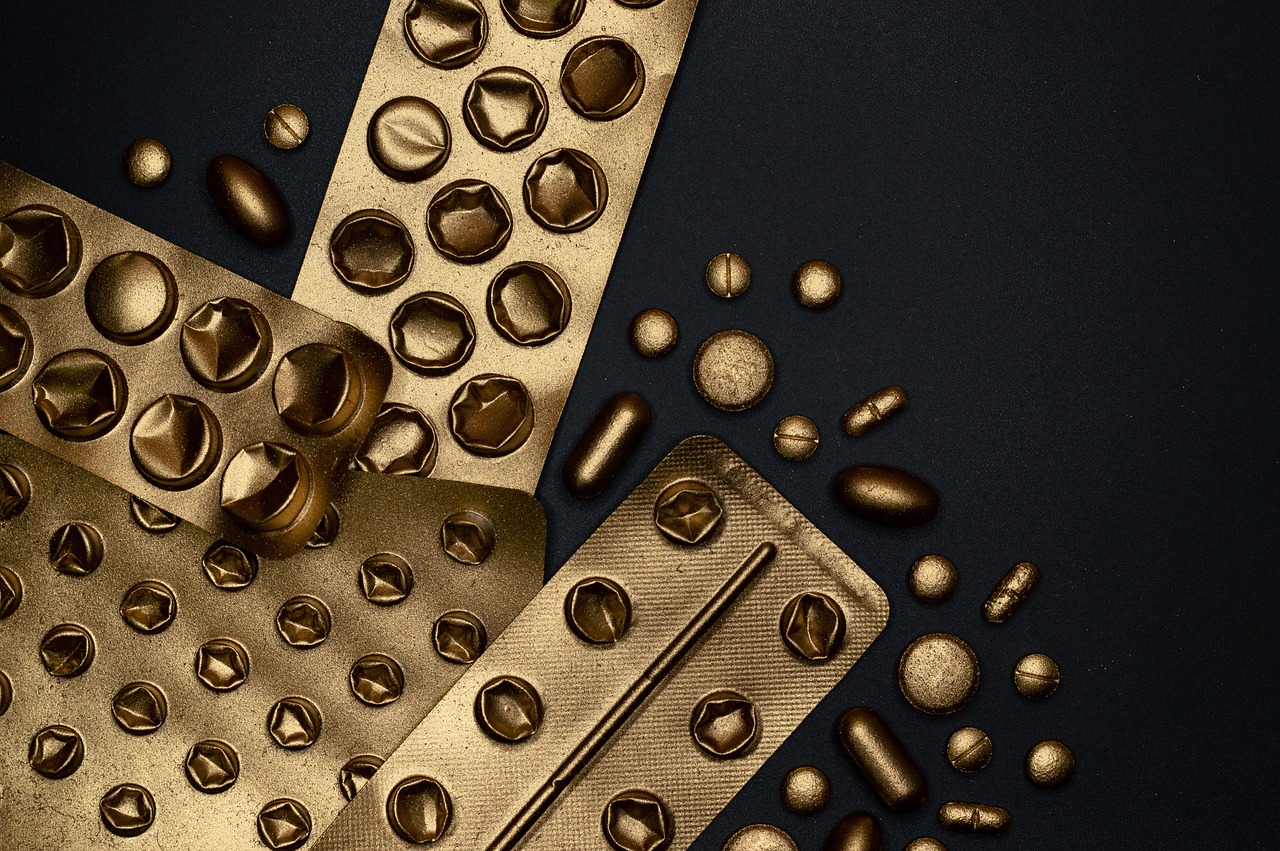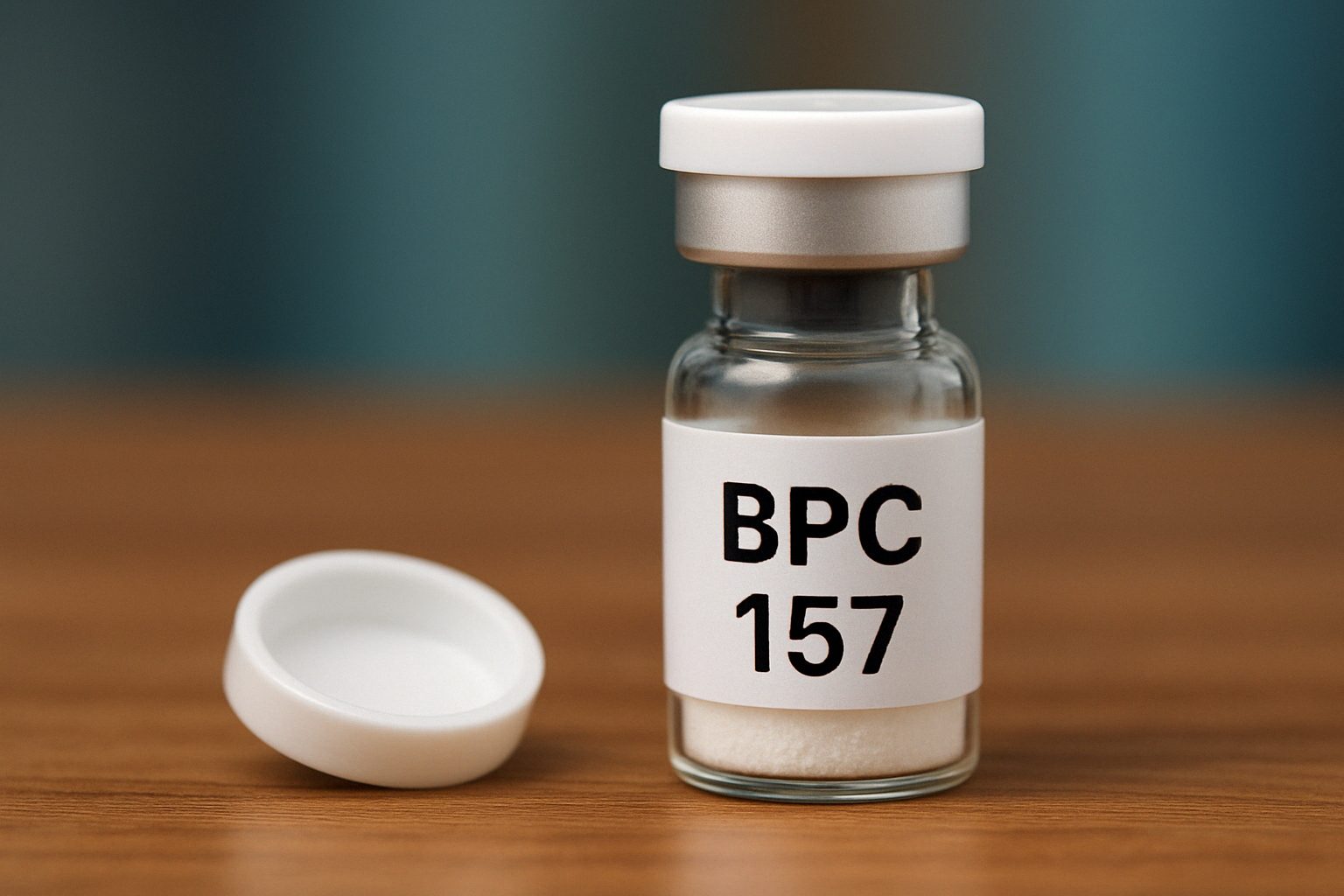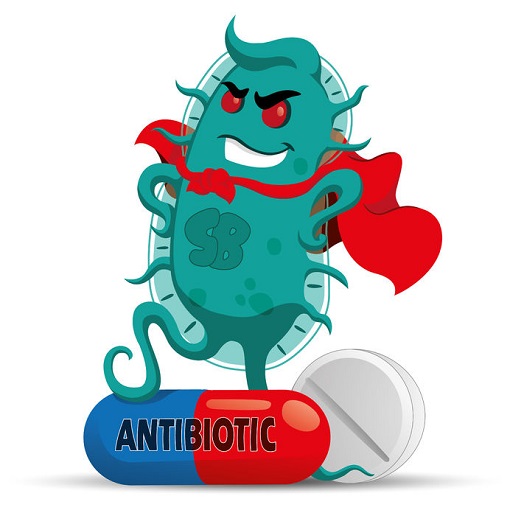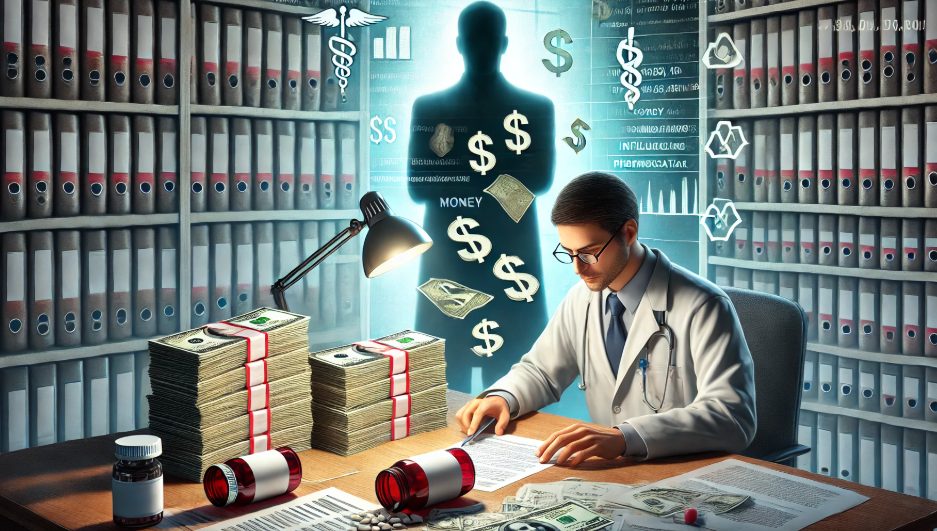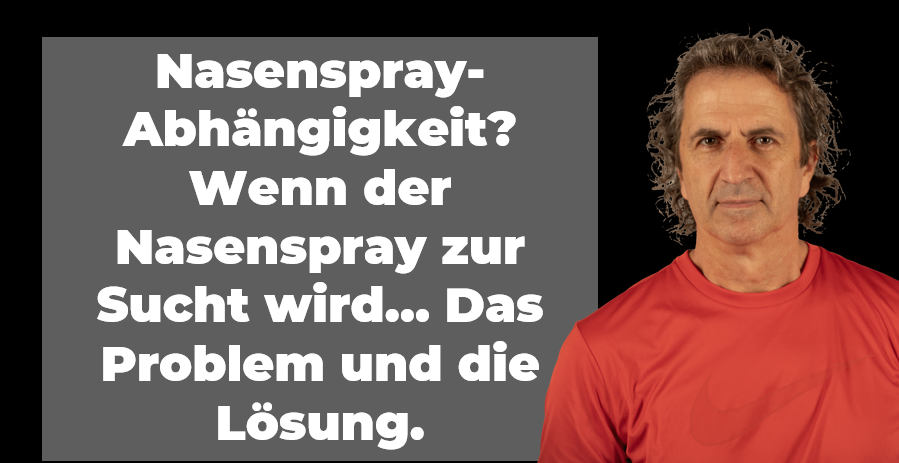Tamiflu ist vielen von Ihnen sicher noch im Zusammenhang mit der Schweinegrippe 2009 bekannt. Und das Mittel erfreut sich immer noch einer gewissen Beliebtheit unter Medizinern.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Hinweis, dass der Coronavirus, die Vogelgrippe, die Schweinegrippe (und überhaupt die Grippe), uns nichts anhaben kann, wenn wir nur an die heilige Mutter Pharma glauben und alles schlucken, was uns von dort aufgetischt wird?
Mit der Schweinegrippe 2009 wurde uns damals auch gleich der Heilsbringer mit serviert: Die Schweinegrippe-Impfung und das Tamiflu. Das Zaubermittel Tamiflu, sollte uns im Fall der Fälle vor dem sicheren Verderben bewahren.
Auch die Namensgebung für das Medikament kommt aus dem Reich der Phantasie: Tami für das englische Verb „to tame“, was „zähmen“ heißt und „flu“ steht für „flunkern“. . . `Tschuldigung. . . für „Grippe“ natürlich. Jedenfalls: Bereits 2009 schrieb ich in diesem Blog hier: Tamiflu – begehrt, aber wirkungslos.
Die „Fachwelt“: Schulmedizin, Presse, Politiker (selbst die Kanzlerin erwähnte den Markennamen Tamiflu) und der kleine Mann auf der Straße waren sich einig: Die Pharmakologie im Speziellen und die Medizin im Allgemeinen haben wieder einmal einen riesigen Schritt nach vorne gemacht.
Kritische Stimmen wurden totgeschwiegen oder die Kritiker als nicht ernst zu nehmend bezeichnet.
Die ganze Diskussion um die Vorzüge des „Virustatikums“ (allen voran Tamiflu) wurde angeheizt durch Panikmache und politische Intervention: Die Bundesländer hatten vom Hersteller vorsorglich für etliche Millionen Euro Vorratspackungen eingekauft, um die Bundesbürger vor dem sicheren Ende zu bewahren.
Denn 2006 stellte man sich in den schillernsten Farben vor, dass das damalige Vogelvirus über Nacht zu einem Virus mutieren kann, das auch für den Menschen üble Folgen bereithält. Bayern allein soll dafür um die 22 Millionen Euro ausgegeben haben.
Und das sichere Ende kam dann auch, aber nicht für die Bürger, sondern für das Medikament.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Wo Wissenschaftler ein neues Medikament „erfinden“ und in Fachzeitschriften „lobpreisen“, waren es ebenfalls Wissenschaftler, die dieses Produkt kritisch unter die Lupe nahmen – zum Glück. Ein internationales Gutachterteam von der Cochrane Collaboration setzte sich mit dem Präparat und seinen Wirkungen bzw. Nebenwirkungen unter anderen Gesichtspunkten auseinander.
Die Cochrane Gruppe besteht aus einer Reihe von Wissenschaftlern, die Studien nachverfolgen bzw. auswerten in Hinsicht auf deren Aussagekraft unter besonderen Gesichtspunkten. Für Tamiflu wurde eigentlich nur eine Analyse der vorhandenen Daten auf die Wirkungs- und Nebenwirkungsrate erhoben.
Das Datenmaterial, was seinerzeit von Roche, dem Hersteller von Tamiflu, veröffentlicht worden ist, zeigte dann auch beeindruckende Ergebnisse: Alles signifikant, wo man auch hinschaut. Besonders überzeugende Ergebnisse konnte ein Virologe aus dem Genfer Universitätsklinikum, Laurent Kaiser, vorweisen.
Er hatte 10 aktuelle Wirksamkeitsstudien untersucht und mehr als eindeutig feststellen können, dass unter einer Tamiflu-Gabe „signifikant“ weniger Patienten an Lungenentzündung erkrankten als ohne bzw. unter Plazebo.
Das Jefferson Team von der Cochrane Collaboration konnte hier feststellen, dass diese Ergebnisse „signifikant“ manipuliert worden waren. Denn alle Studien waren vom Hersteller selbst durchgeführt worden.
Aber da diese Ergebnisse so überzeugend waren, wurden sie von der gesamten Welt gläubig ins Abendgebet aufgenommen. Sogar die Cochrane Wissenschaftler gingen der Schlamperei zu Beginn auf den Leim. Erst 2009 bekamen sie vom britischen National Institute for Health Research den Auftrag, diesen ganzen Komplex noch einmal wissenschaftlich aufzurollen.
Denn es kam Kunde aus Japan, wo Ärzte, wie Keji Hayashi, die Wissenschaftler darauf aufmerksam machten, dass die veröffentlichten Daten mit der klinische Praxis nicht in Einklang zu bringen seien.
Dazu kommt noch, dass die Autoren der berühmten Tamiflu-Übersichtsstudie Angestellte und bezahlte Berater vom Tamiflu-Hersteller sind. Die 10 Studien, die untersucht worden sind, sind in 8 Fällen überhaupt nicht veröffentlicht worden. Nur 2 wurden als koscher genug befunden, den Weg in eine Veröffentlichung zu gehen. Warum also wird 80 Prozent des Studienmaterials unter den Teppich gekehrt und 20 Prozent stellvertretend für 100 Prozent verkauft?
Um dieser Frage nachzugehen fragte das Jefferson Team Kaiser um die vollständigen Daten. Der aber verwies diese an die Firma Roche, und die wollten eine Verschwiegenheitserklärung, falls man die richtigen Daten aushändigte. Anders ausgedrückt: Die Jefferson Gruppe durfte die Daten ansehen, durfte aber zu niemanden darüber Aussagen machen, geschweige Veröffentlichungen darüber erstellen. Aha? Gibt es hier etwas zu verheimlichen?
Wenn die Datenlage so eindeutig „signifikant“ ist, warum wird dann nicht damit in der wissenschaftlichen Weltgeschichte umhergeschmissen wie in Köln zum Karneval mit Kamellen?
Die Jefferson Gruppe zog aus diesem Verhalten die Konsequenzen und veröffentlichten die Lücken und Ungereimtheiten der Kaiser-Veröffentlichung. Sie erstellten eine neue Bewertung des Präparat auf der Grundlage von Studien, die vollständig veröffentlicht worden waren.
Tamiflu nicht besser als Placebo?
Das Ergebnis war „signifikant“: Tamiflu schneidet nicht besser ab als ein Plazebo – ein Ergebnis, das der Einschätzung der japanischen Wissenschaftler um Keji Hayashi entspricht.
Nachdem das Kind für Roche in Bausch und Bogen in den Brunnen gefallen war, wurde die Firma rege. Sie versprach, die fehlenden Daten nachzureichen, allerdings unter recht komplizierten Bedingungen – passwortgeschützte Webseite, unvollständige Daten wiederum etc. Das zögerliche Herausrücken der Originaldaten muss leider die Frage zulassen: Werden die Daten erst einmal wieder zurechtgeschrieben, um die gewünschten Ergebnisse zu liefern?
Die ersten veröffentlichten Daten wurden von Jefferson und seiner Gruppe als manipuliert erkannt, und „Schwupps“ waren die Daten von mehr als der Hälfte der Studienteilnehmer verschwunden (2691 von 4813). Auch im Reich der Nebenwirkungen konnten die Jefferson Leute eine Reihe von bunten Kühen begegnen.
Die offizielle Darstellung für Tamiflu sieht so aus, dass es keine und wenn, dann unbedeutende Nebenwirkungen gegeben hat. Zurück aus dem Märchenwald zeigten sogar die unvollständigen Daten, dass es 10 schwere Zwischenfälle bei 9 Patienten gegeben hatte.
Auch hier hatten die japanischen Wissenschaftler das gleiche Bild geliefert: Kinder unter Tamiflu zeigten gehäuft psychotische Veränderungen. Naja, und wenn man sich nicht anders zu helfen weiß, setzt man noch einen oben drauf. So behauptet Roche stock und steif der Süddeutschen Zeitung gegenüber, dass es keine Datenlücken gibt. Wörtlich: „Roche glaubt, dass es alle Daten zur Verfügung gestellt hat. . . „
Aber glauben heißt ja nicht wissen. Warum also weiß Roche nicht, ob sie alle Daten abgegeben hat. Da bleibt doch nur die Vermutung: Roche glaubt nicht, Roche weiß, dass sie NICHT alle Daten zur Verfügung gestellt hat – oder?
Danach geht man in die Offensive und teilt den Gutachtern mit, dass die Firma darüber entscheidet mit welchem Material die Gutachter zu arbeiten haben. Der Kommentar von Tom Jefferson: „Eine verkehrte Welt! Seit wann entscheiden die Begutachteten, was der Gutachter sehen darf – und was nicht?“
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Aber es gab ja noch: Relenza!
Aber auch Glaxo hat eine glorreiche Vergangenheit in Sachen Datenmanipulation und – unterdrückung (Avandia unlängst). Somit ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Datenlage für Relenza, das Glaxo Pendant zu Tamiflu, vermutlich auch nicht alles ganz in Ordnung ist.
Tut mir leid, aber der gute Wille ist mir bei solchen Machenschaften abhanden gekommen. Die größte Studie mit Relenza in den USA zeigte im Vergleich zu Plazebo übrigens keinen besseren Effekt. Auch sie verschwand in den Katakomben der medizinischen Geheimwissenschaften und wurde nie veröffentlicht.
Fazit der Jefferson Gruppe: Wo man auch hinschaut, man sieht manipulierte Daten. Medizinisch-wissenschaftliche Studien . . . Hollywood für Weißkittel. Mein Fazit: Nichts Neues für mich. Wenn Sie möchten schauen Sie sich auch mal die Reportage von Frontal21 DAS PHARMAKARTELL an. Spätestens dann dürfte einiges klarer werden…
Tamiflu: Die „wahren“ Wirkungen enthüllt
Die wahren Wirkungen von Tamiflu enthüllten die englischen Forscher Peter Doshi und Carl Heneghan, die immer wieder nachfragten und recherchierten.
In den letzten Jahren wurden sie nicht müde Daten zu sammeln und auf die Herausgabe der Studiendaten zu Tamiflu zu drängen. Und: die Auswertungen belegen das Täuschungsmanöver des Pharmariesen.
Das Cochrane-Netzwerk hat zusammen mit dem British Medical Journal die 550 Seiten umfassende Dokumentation veröffentlich und Regierungen und Verantwortliche der Gesundheitspolitik dazu aufgerufen, die Grippemittel nicht weiter einzusetzen. Die umfangreiche Analyse zeigt, dass die enthaltenen Neuraminidasehemmer bei Grippe praktisch wirkungslos sind. Dies wurde bereits seit 2009 in mehreren Fachpublikationen aufgezeigt.
Nebenwirkungen: von Übelkeit bis Schizophrenie
Keine der propagierten Wirkungen wie Schutz vor Bronchitis, Mittelohrinfektion, Nebenhöhleninfektion oder Lungenentzündungen sind nachweisbar. Unangenehme Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen waren um fünf Prozent erhöht, ein Prozent der Personen erkrankte gar an Schizophrenie.
Diese Ergebnisse sind wahrhaftig „zum Kotzen“ und erzeugen bei mir größte Übelkeit! Paradox ist zudem, dass durch die Medikamenteneinnahme das Immunsystem geschwächt wird, da die körpereigenen Antikörper reduziert werden.
Milliardenverluste für viele Staaten
Deutschland hatte bereits im Zuge der Vogelgrippe 2007 mit der Bevorratung der Grippemittel begonnen und gab schätzungsweise 500 Millionen Euro aus, die USA etwa 1,3 Milliarden. Viele andere Staaten bestellten von Roche Tamiflu (Oseltamivir) oder von GlaxoSmithKline Relenza (Zanamivir). Der weltweite Umsatz betrug für die Herstellerfirmen wohl mehr als 10 Milliarden Euro.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Zweifel an der Wirksamkeit bereits seit 2009!
Völlig unverständlich erscheint die Anschaffung der Grippemittel auch deshalb, weil seit 2009 die Wirksamkeit bereits stark angezweifelt wurde (siehe mein Beitrag oben), denn nur 40 % der Daten waren veröffentlicht, der Großteil wurde von Roche mit fadenscheinigen Ausreden zurückgehalten.
Dabei sollte allein schon die Verweigerung der Datenherausgabe Anlass zum Misstrauen geben, ohne ausreichend positive Belege viele Millionen zu investieren. Erst 2013 (!) machte Roche unter dem Druck der Forscher um Peter Doshi die Daten zugänglich, die das ganze Ausmaß der Wirkungslosigkeit und Gefährlichkeit offenbarten.
Da weder die WHO, die europäische oder amerikanische Seuchenschutzbehörde noch die europäische Arzneimittelagentur die Datensätze anforderten und die Regierungen sich auf die unfähigen Behörden beriefen, konnte die Geldverschwendung weitergehen. Doshi bezeichnete den Totalausfall politischer und regulatorischer Organe treffend als „Multiorganversagen“. Ich kann mich dieser Beurteilung nur anschließen.
Regierungen ziehen KEINE Konsequenzen
Viele Führungspersonen haben nicht den Mut zu sagen, dass es gegen eine Epidemie kein wirksames Medikament gibt. Einzelne Stimmen fordern jetzt zwar die zukünftige Verpflichtung von Pharmafirmen und Gesundheitsbehörden zur lückenlosen Veröffentlichung aller Daten.
Doch offenbar hat der Skandal trotz seiner enormen finanziellen Verluste noch immer zu keinem Umdenken geführt. Dies legt etwa die Reaktion der bayrischen Gesundheitsbehörden nahe, die sich auch jetzt auf die positive Beurteilung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) berufen.
Auch die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kordula Schulz-Asche, Dr. Harald Terpe, Maria Klein-Schmeink, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 18/1227), lässt eigentlich keine anderen Schlüsse zu:
Frage: Plant die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Cochrane-Collabortation den vorsorglichen Ankauf und die weitere Bevorratung von Tamiflu und Relenza auf Bundesebene einzustellen und ein entsprechendes Vorgehen mit den Bundesländern abzustimmen?
Antwort: Aufgrund der bestehenden Vorräte an Neuraminidasehemmern bei Bund und Ländern besteht derzeit bundesweit keine Notwendigkeit, über die weitere Bevorratung mit Neuraminidasehemmern zu entscheiden.
Da bleibt nur die Hoffnung, dass verantwortungsbewusste Menschen wie Peter Doshi nicht schweigen, bis sich etwas ändert. Und man darf sich schon mal fragen, WER in diesem Land eigentlich das sagen hat?
FAZIT: Der Fall der Grippemittel Tamiflu und Relenza zeigt klar und deutlich: Die Pharmaindustrie ist anscheinend nur auf maximale Gewinne aus. Doch es ist nicht nur die Nutzlosigkeit der Medikamente und die Millionen die dafür ausgegeben wurden.
Der wirkliche Skandal sind teilweise sehr gefährlichen Nebenwirkungen. Konsequenzen: keine. Die betroffenen Patienten und die Steuerzahler haben halt Pech gehabt. Ich wünschte dieser (wohl teuerste) Medizinskandal wäre ein Einzelfall. Leider gibt es weitere zahlreiche fragwürdige Pharmaprodukte, beispielsweise Impfstoffe mit Quecksilber oder Cholesterinsenker mit Statinen. Wann wird endlich mal „aufgeräumt“?
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Dieser Beitrag wurde von mir erstmalig am 7. Januar 2011 veröffentlicht und letztmalig am 18.3.2015 ausführlich überarbeitet und am 13.1.2026 geringfügig ergänzt.
Weitere Informationen zum Thema: