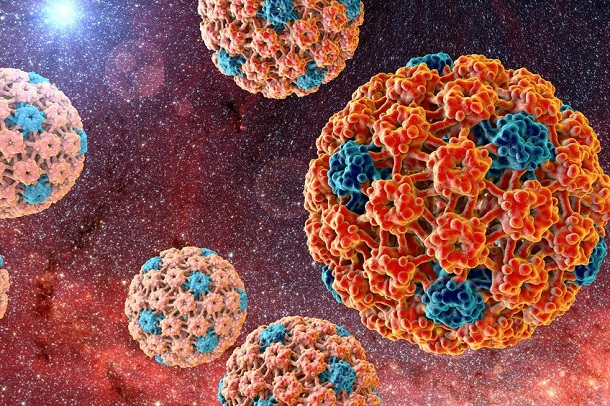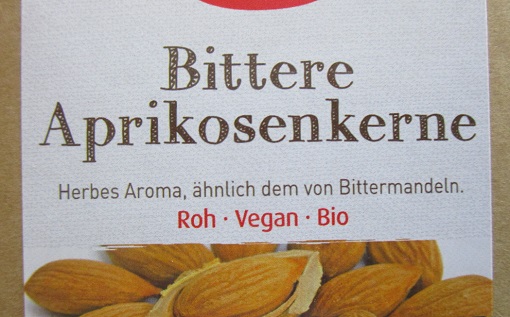In der modernen Krebsforschung beginnt sich gerade ein stiller Paradigmenwechsel abzuzeichnen. Immer mehr Studien zeigen, dass Metastasen nicht – wie seit Jahrzehnten behauptet – primär durch genetische Mutationen getrieben werden. Sondern durch epigenetische Programme, die direkt vom Zuckerstoffwechsel und damit von unserem Lebensstil gesteuert werden.
Zu dieser Erkenntnis kommt jetzt auch eine Forschungsarbeit der Johns Hopkins Universität und des Memorial Sloan Kettering Cancer Centers – zwei der weltweit einflussreichsten onkologischen Zentren. Und ihre Daten sind brisant: In aggressiven Metastasen fanden die Forscher keinerlei neue Mutationen. Dafür aber tiefgreifende epigenetische Umprogrammierungen – direkt gekoppelt an den Glukosestoffwechsel. Es geht um diese Studie: Epigenomic reprogramming during pancreatic cancer progression links anabolic glucose metabolism to distant metastasis.
Für diese Arbeit entnahmen die Autoren Tumorproben von acht Patienten, die an Pankreaskrebs erkrankt und daran verstorben waren. Die Proben wurden vom Primärtumor in der Bauchspeicheldrüse entnommen und zudem von Tumoren, die als Metastasen in anderen Organen und Geweben entdeckt werden konnten.
Danach wurde ein genetisches Profil für alle Tumore erstellt und miteinander verglichen. Ziel des Vergleichs war, Unterschiede im genetischen Profil zu ermitteln und damit Mutationen zu bestimmen. Das Ergebnis zeigte jedoch, dass in keinem Fall eine Mutation zu sehen war.
Damit stellte sich die Frage, welcher Mechanismus für die Metastasenbildung verantwortlich ist, wenn Mutationen hierfür ausscheiden. Dafür sahen die Autoren anstelle der vermuteten Mutationen Veränderungen im sogenannten Epigenom.
Ähnlich wie man unter dem Begriff „Genom“ die Gesamtheit der Erbinformationen versteht, bezeichnet der Begriff „Epigenom“ die Gesamtheit aller epigenetischen Vorgänge und Zustände. Das Epigenom bildet einen Komplex von reversiblen biochemischen und strukturellen Veränderungen in Bezug auf die DNA und seinen Proteinen, die es umfassen.
Dabei wird die grundsätzliche Information der DNA nicht verändert. Denn eine solche Veränderung ist die Grundlage für eine Mutation. Epigenetische Veränderungen dagegen bestimmen das Ausmaß, mit dem spezifische Gene genutzt oder abgeschaltet werden.
Die Autoren sahen keine großen Veränderungen in den Tumoren, die im Bereich der Bauchspeicheldrüse entdeckt werden konnten. Tumore, die als weit entfernte Metastasen in Lunge und Leber auftauchten, zeigten dagegen massive epigenetische Veränderungen, die sich auf große, blockartige Segmente der Zell-DNA bezogen. Diese Veränderungen bezogen sich auf große Bereiche des Chromatins.
Übrigens: Wenn Sie so etwas interessiert, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Newsletter
„Hoffnung bei Krebs“ dazu an:
Chromatin ist der Baustoff, der für die Bildung der Chromosomen notwendig ist. Es handelt sich hier um einen Komplex aus DNA und Proteinen, die zur Hälfte für die Bildung von Histonen zuständig sind. Histone sind eine Art „Verpackungsmaterial“ für die DNA.
Die Autoren berichten weiter, dass es eine bemerkenswerte Verbindung zum Kohlehydratstoffwechsel gibt. Denn diese epigenetischen Veränderungen in den Metastasen schienen abhängig zu sein vom sogenannten Pentosephosphatweg.
Es handelt sich beim Pentosephosphatweg um einen Stoffwechselweg, der eine zentrale Rolle bei der Verwertung von Kohlenhydraten spielt, besonders der Glukose.
Das heißt, dass mit einem verbesserten Angebot an Glukose diese epigenetischen Veränderungen durchgesetzt werden können, und damit die Metastasenbildung begünstigt wird. Die Autoren sahen ebenfalls, dass eine Hemmung dieses Stoffwechselwegs zu einer Umprogrammierung des Chromatins führte, was verbunden war mit einer Blockierung der malignen Genexpression und Tumorgenese.
Die biochemischen Tests zeigten, dass weit entfernte Metastasen besonders hohe Mengen an Glukose beanspruchten im Vergleich zu Metastasen, die in der Bauchspeicheldrüse oder näheren Umgebung lokalisiert waren.
Damit liegt der Verdacht sehr nahe, dass eine Diät, die arm an Kohlenhydraten ist, wie zum Beispiel die ketogene Diät, eine Prophylaxe oder möglicherweise auch eine (begleitende) Therapie gegen Metastasenbildung sein könnte.
Artikel meinerseits, die in die gleiche Richtung deuten, hatte ich bereits vor einiger Zeit verfasst:
Unter diesen Verhältnissen und mit diesem neuen Erkenntnissen wird der Zucker in ein noch schlechteres Licht gestellt als er ohnehin schon steht: Zucker – der süße Kassenschlager. Und dass nicht von „esoterischen Alternativmedizinern und Schamanen“, sondern von anerkannten Institutionen der Schulmedizin.
Der Leiter dieser Studie, Professor Feinberg, vermutet, dass diese epigenetische Veränderung der blockartigen Segmente auch bei anderen Krebsformen vorkommen könnte. Er sagt hierzu, dass diese Vermutung noch nicht überprüft worden ist.
Man weiß jedoch, dass ähnliche epigenetische Regionen bei anderen Krebsformen aufgefallen sind, wie zum Beispiel bei Dickdarmkrebs. Daher liege die Vermutung nahe, dass diese breitflächig angelegten epigenetischen Veränderungen bei anderen Krebsformen ebenfalls von zentraler Bedeutung sind.
Die epigenetischen Veränderungen in den Metastasen bewirkten nicht nur einen erhöhten Glukosebedarf der Tumorzellen, sondern veränderte die Genaktivität der Zellen dahingehend, dass die Zellen Vorteile in Bezug auf Migration (weitergehende Metastasenbildung) und Resistenz gegen eine Chemotherapie erlangten. Dies würde auch die Aggressivität und Gefährlichkeit von Metastasen erklären.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Der schulmedizinische Schwenk
Die Schulmedizin wäre nicht die Schulmedizin, wenn sie nicht auch hier eine Möglichkeit für pharmakologische Eingriffe sehen würde. Die noch nicht zugelassene Substanz, die hier zum Einsatz kam, blockierte den Pentosephosphatweg, genauer gesagt die Glukose-6-phosphat-Dehydrogenase, die Teil des Pentosephosphatwegs ist.
Sie heißt „6-Aminonicotinamid“, kann aber in dieser Form nicht beim Menschen eingesetzt werden, da sie extrem viele Nebenwirkungen mit sich bringt. Die Beobachtungen, die hier geschildert werden, sind reine Laborversuche und bislang noch weit von einer klinischen Prüfung entfernt.
Das Ziel weiterer Bemühungen scheint zu sein, eine Substanz zu entwickeln, die den Pentosephosphatweg und damit die epigenetischen Veränderungen und die sich daraus ergebende Metastasenbildung blockiert, ohne dabei tiefgreifende Nebenwirkungen zu verursachen.
Eine solche Substanz wäre möglicherweise der „Durchbruch“, von dem die Schulmedizin regelmäßig schwärmt (und träumt). Denn mit einer solchen Substanz könnte man auch weiter Zucker ohne Ende genießen, ohne das Risiko Krebserkrankungen zu erhöhen.
Damit wären Zuckerhersteller und Lebensmittelindustrie „aus dem Schneider“. Die Pharmaindustrie hätte ein Super-Medikament gegen eine Erkrankung, vor der jeder Angst hat. Und die Schulmedizin hätte ein Medikament, von dem sie schon lange geträumt hat.
Nachdem wir aus diesem profitträchtigen Traum aus dem Märchenland aufgewacht sind, drängt sich bei mir die Idee auf, es einmal mit etwas mehr Menschenverstand zu versuchen. Denn wo kein Zucker ist, gibt es auch keinen Pentosephosphatweg, der im physiologischen Overdrive zu epigenetischen Veränderungen führt. Aber solche Ideen haben natürlich absolut kein Marktpotenzial.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Fazit
Es gibt immer mehr Hinweise und Belege, jetzt auch seitens der Schulmedizin, dass Krebserkrankungen durch die Ernährung zumindest begünstigt, wenn nicht sogar initiiert werden. An erster Stelle steht hier Zucker, der sich als integraler Bestandteil in jeder Form von industriell erzeugten Nahrungsmitteln befindet.
Während die Schulmedizin Statistiken bemüht, die „beweisen“, dass Impfungen Infektionskrankheiten besiegt haben, scheut sie sich, ähnliche Statistiken für Ernährung und erhöhtes Krebsaufkommen zu erstellen und zu hinterfragen.
Denn der Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum, der über die letzten 100 Jahre stetig zugenommen hat, und dem stetig steigenden Auftreten von Krebserkrankungen, ist inzwischen kaum noch zu leugnen.
Aber auch hier wird nur das anerkannt, was in die gängige Ideologie passt und nicht was der Realität entspricht. Evidenzbasiert? Ein Wort, das die Schulmedizin schnell vergessen sollte.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…