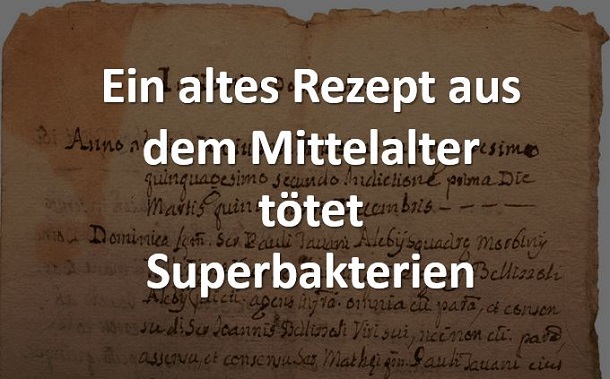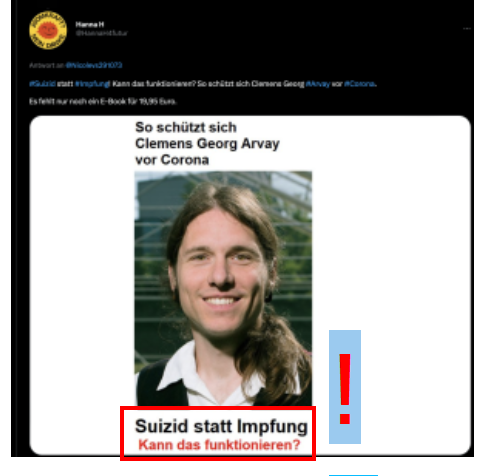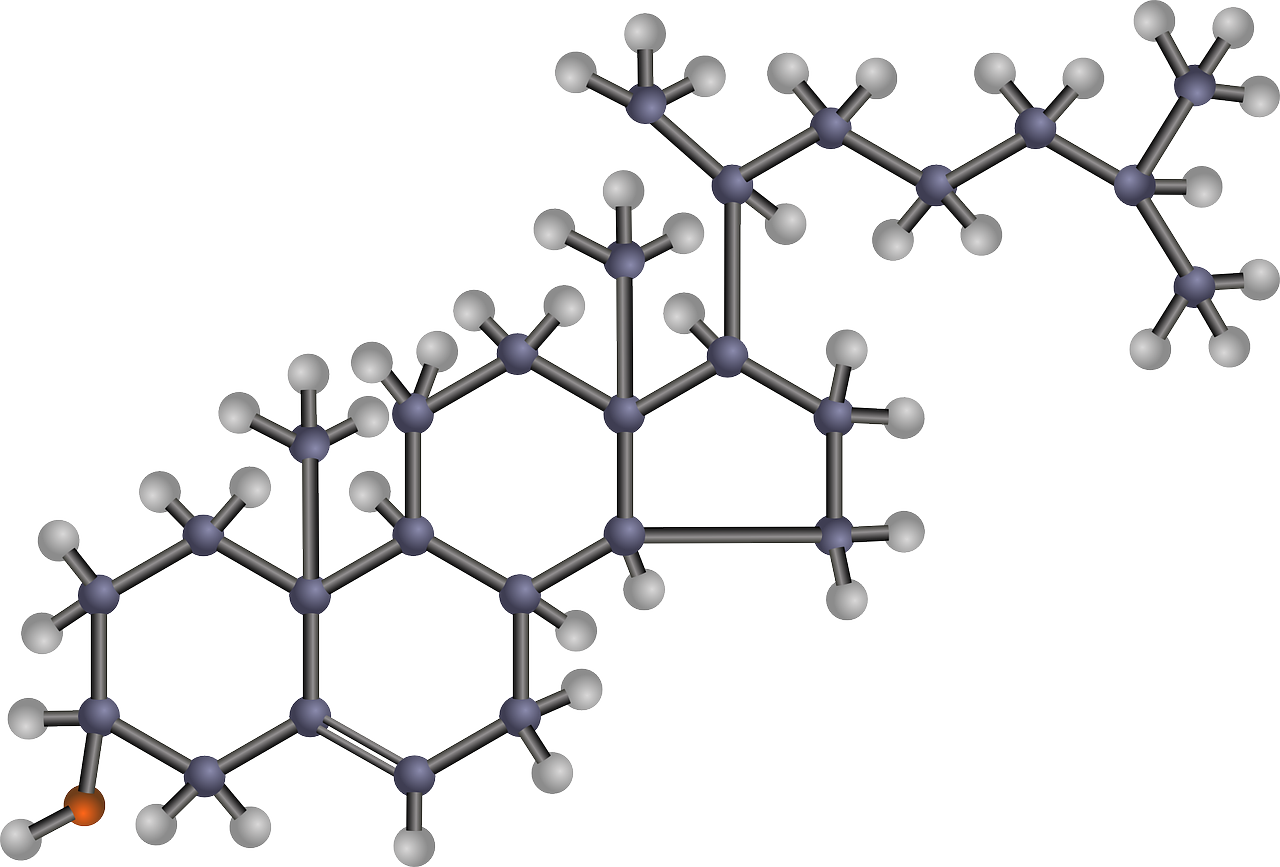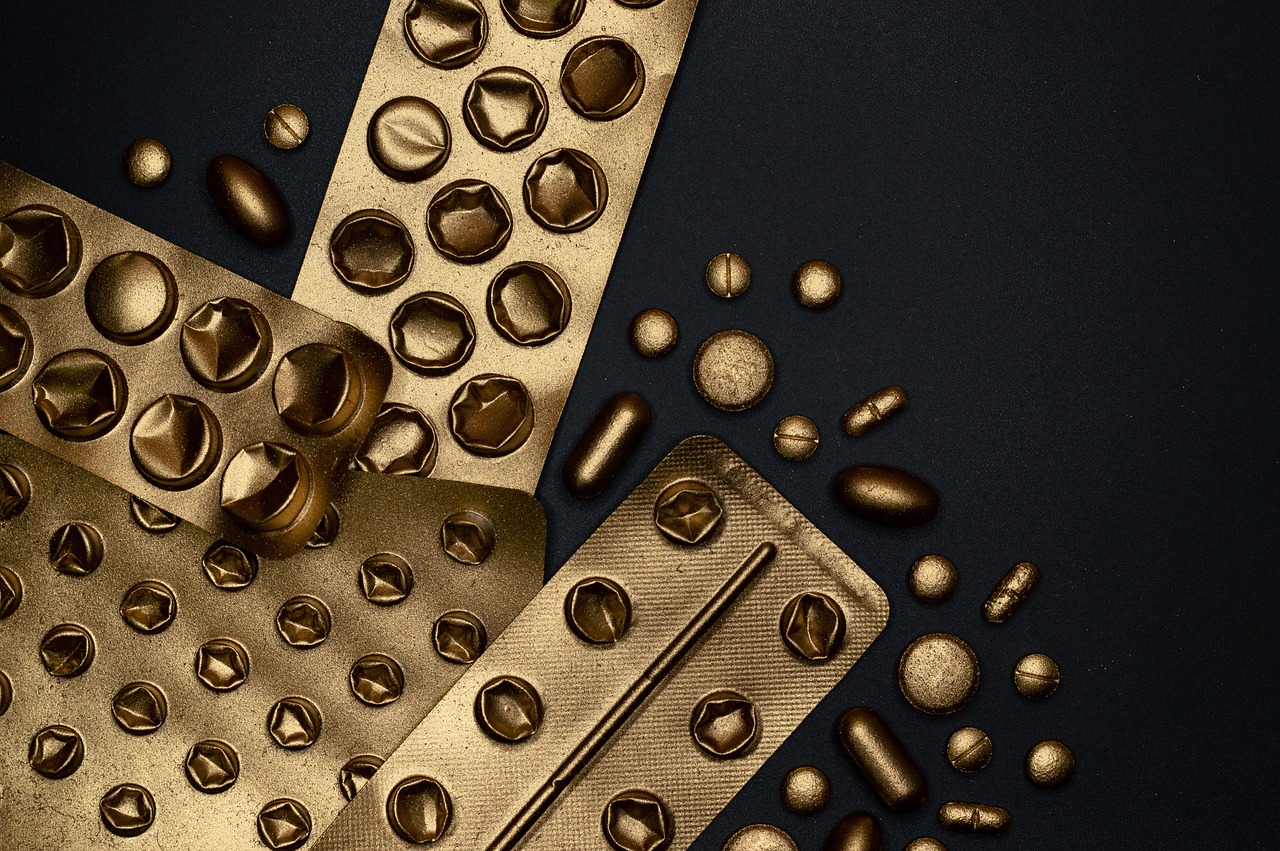Aus der Naturheilpraxis von René Gräber / Kategorie: Heilpflanzen, Heilverfahren
Manchmal frage ich mich, ob wir verlernt haben, zu staunen. Da entdecken Forscher ein tausend Jahre altes Rezept – Wein, Knoblauch, Zwiebeln, Gallensekret – und müssen verblüfft feststellen: Es tötet antibiotikaresistente Keime. Etwas, woran unsere moderne Medizin heute verzweifelt.
Das ist kein Märchen aus alten Kräuterbüchern, sondern ein Laborergebnis des 21. Jahrhunderts. Und doch reagiert man vielerorts nur mit einem Achselzucken. Vielleicht, weil nicht sein kann, was nicht ins Geschäftsmodell passt.
Ich sehe darin etwas anderes: eine Erinnerung. Die Natur hat nie aufgehört, Heilmittel bereitzuhalten – wir haben nur aufgehört, sie zu suchen. Während die Pharmakonzerne weiter an synthetischen Ersatzstoffen basteln, zeigt ein uraltes Rezept aus dem Mittelalter, dass Heilung sich nicht erfinden lässt. Sie folgt Gesetzen, die älter sind als jede Studie – und sie wirken noch immer, wenn man sie lässt.
In diesem Beitrag möchte ich Ihnen zeigen, warum dieses vergessene Heilmittel nicht nur Geschichte schreibt, sondern Zukunft hat – und was wir daraus über die wahren „Antibiotika“ der Natur lernen können.
Worum geht es genau? Das „Super-Rezept“
Eine Historikerin und eine Biologin testen ein altes Rezept aus dem Mittelalter und sind verblüfft, dass es wirkt. Dazu weiter unten gleich mehr.
Wenn Sie bereits regelmäßig bei mir mitlesen, wissen Sie, dass das kein Einzelfall ist. Die Natur heilt – immer. Aber seit Jahrzehnten ist unsere Gesellschaft derart „gehirngewaschen“, dass sie meint, ohne die chemisch-pharmazeutischen Mittel der „Industrie“ nicht mehr auszukommen…
Antibiotika gelten als ein „Segen der Menschheit“, was ich nicht bestreiten möchte. Jedoch wurde und wird dieser Segen so intensiv und extensiv eingesetzt, dass er sich nun in sein komplettes Gegenteil zu verwandeln droht.
Denn mit dem gedankenlosen Einsatz der Antibiotika (auch gegen abstehende Ohren und verwandte Erkrankungen) gab man den Krankheitserregern ausgiebig Gelegenheit, sich an die neue Situation anzupassen.
Durch Mutation und Selektion, ein Begriffspaar aus der Populationsgenetik, entstanden bei den Keimen Varianten, die sich von der Chemie des Menschen unbeeindruckt zeigten: Die resistenten Krankheitserreger waren geboren.
Wie die Schulmedizin mit ihrer „Errungenschaft“ umgeht und deren Wirksamkeit verspielt, das habe ich bereits in mehreren Beiträgen zum Besten gegeben:
Natürlich weiß man inzwischen in der Schulmedizin um diese Gefahr – zumindest gibt man vor, dies zu wissen.
Warum der Antibiotika-Verbrauch trotzdem zu steigen scheint, ist nur dann verständlich, wenn man weiß, dass rund 70 Prozent der verkauften Antibiotika in der Tierzucht zum Einsatz kommen.
Ergo: Es wird mehr gezüchtet, also braucht man auch mehr Antibiotika. Das tut aber der Resistenzentwicklung keinen Abbruch – im Gegenteil. Hier haben die bereits resistenten Krankheitserreger ausgiebig Gelegenheit, ihre Resistenz-Gene untereinander auszutauschen und zu verbreiten.
Die einschlägige Presse und öffentlichen Meinungsmacher sind sich einig, dass hier Panik angesagt ist:
Auch diese Beiträge des „Spiegel“ sind schön schaurig: Resistente Bakterien: WHO warnt vor Ära tödlicher Infektionen oder Antibiotika-Resistenz: Neuer Salmonellen-Stamm ist unbesiegbar.
Nachdem wir also jetzt in „Endzeitstimmung“ sind, stellt sich die Frage, was man da noch machen kann?
Da der Verkauf von Antibiotika stetig zunimmt, kann ein sparsamer und gezielter Einsatz nicht die Lösung sein. Denn dies würde die Wettbewerbsfähigkeit der Antibiotika-Hersteller gefährden. Und das ist noch viel schlimmer als jede Antibiotika-Resistenz. Aber was dann? Man kann nur noch resignieren. Denn ohne die Schulmedizin und ihre Chemie sind wir ja alle angeblich dem Untergang geweiht.
Es gibt da noch die alternativmedizinischen Ansätze, die von „natürlichen Antibiotika“ reden. Aber das ist frommes Wunschdenken.
Denn wir sind heute schon so „hirnmanipuliert“, dass wir Gesundheit und Heilung nur noch von chemischen Präparaten erwarten.
Das, was die Natur zu bieten hat, ist bestenfalls zweite Wahl. Chemie schlägt Biologie erzählt man uns jedenfalls – und die Mehrheit glaubt das auch noch…
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Natürliche Antibiotika – besser als die Schulmedizin erlaubt
Einige Antibiotika, zum Beispiel das Penicillin, sind eigentlich keine rein chemischen = synthetischen Substanzen, sondern Naturprodukte, die im Falle des Penicillins von Schimmelpilzen produziert werden.
Wer die Vielfalt der Natur kennt, dem wird es nicht schwer fallen, anzunehmen, dass auch in diesem Segment eine Vielzahl an Substanzen durch verschiedene Organismen gebildet werden, die antibiotischen Charakter haben und als natürlicher Schutz gegen Krankheitserreger dienen.
Und dies ist nicht auf die Tierwelt beschränkt. Auch Pflanzen kennen diesen Schutzmechanismus. Um welche Pflanzen und Substanzen es sich handelt, das habe ich in folgendem Beitrag diskutiert: Natürliche und pflanzliche Antibiotika: Schutz vor Infektionen und bakteriellen Erkrankungen
Es handelt sich hier allerdings nur um einen „Appetitanreger“ für ein umfassenderes Werk, dass ich in Bälde (hoffentlich) als Buch/Report herausbringen werde, wo alles Wissenswerte (aus meiner Sicht) zur Frage der natürlichen Antibiotika zusammengefasst sein wird.
Während man sich in Presse und Gesundheitsministerium noch die Köpfe heiß redet, was man mit MRSA und anderen Resistenzen machen kann, kommt eine verrückte Botschaft von den britischen Inseln. Und die lautet, dass es dort schon vor über 1000 Jahren Antibiotika gegeben hat.
Da zu dieser Zeit noch keine weißen Kittel erfunden worden waren, kann man getrost diese Botschaft zu den alchemistischen Märchenerzählungen der Gebrüder Shakespeare zählen, oder doch nicht?
1000 Jahre altes Rezept killt antibiotikaresistente Keime
Denn… die Meldung lautete frech: „1,000-year-old onion and garlic remedy kills antibiotic-resistant bugs“, was so viel heißt wie „1000 Jahre altes Heilrezept mit Zwiebeln und Knoblauch vernichtet antibiotikaresistente Keime“.
Das ist schon ein starkes Stück. Hier wird behauptet, dass nicht nur Krankheitserreger vernichtet werden, sondern obendrein auch noch antibiotikaresistente Keime, wie MRSA. Sind nicht die Halbgötter in Weiß heute ohnmächtig gegenüber diesen Keimen?
Und jetzt will ein Rezept von einer 1000-jährigen Ururoma mehr können als die gesamte Innung der Mediziner der Neuzeit? Es kann sich hier nur um einen typisch britischen Humor schwärzester Machart handeln – oder?
Man muss aber bei der Interpretation des Rezepts den britischen Medizinern zugute halten, dass diese selber nicht an die Wirksamkeit der Rezeptur geglaubt hatten, anfänglich. Gefunden wurde das Rezept in einer Bibliothek für alte englische Literatur und stammt aus dem 9. Jahrhundert.
Nachdem Literaturexperten den Text ins zeitgenössische Englisch übersetzt hatten, machte sich ein Team von Mikrobiologen ans Werk, die Rezeptur so originalgetreu wie nur möglich nachzubauen. Was dabei herauskam, kommentierte die Leiterin des Team, Dr. Freya Harrison, so:
„Wir dachten, dass Bald´s eye salve (so heißt die Rezeptur im Originaltext) überhaupt keine Spur eines antibiotischen Effekts haben kann. Wir waren aber vollkommen überwältigt, wie effektiv die Kombination der Zutaten war.“
So sah das Originalrezept aus
Das Rezept stammt aus dem angelsächsischen „Bald’s Leechbook“, einer medizinischen Handschrift aus dem 9. Jahrhundert. Die Überschrift lautete schlicht: Wiþ wyrm on eagum – „Gegen eine Entzündung im Auge“.
Und so wurde die Rezeptur beschrieben – wortwörtlich übersetzt und heute in mehreren Laboren erfolgreich rekonstruiert:
Zutaten:
- 1 Teil Lauch oder Zwiebel (nach Textstelle austauschbar)
- 1 Teil Knoblauch
- 1 Teil Wein – vorzugsweise ein heller, möglichst naturbelassener
- 1 Teil Rindergalle (frisch aus der Gallenblase)
Zubereitung:
- Zwiebel und Knoblauch fein zerstoßen.
- Mit gleichen Teilen Wein und Galle vermischen.
- In einem Messinggefäß (nicht Eisen!) ansetzen.
- Neun Tage lang stehen lassen – kühl, dunkel, gut abgedeckt.
- Nach dieser Zeit durch ein sauberes Tuch abfiltrieren.
- Anwendung ursprünglich als Augensalbe gedacht – bei eitrigen oder entzündlichen Augenleiden.
Die Forscher der University of Warwick und der University of Nottingham haben die Rezeptur exakt so nachgebildet – mit gleichen Gewichtsanteilen (z. B. 25 g Knoblauch, 25 g Zwiebel, 25 ml Wein, 25 ml Galle) und neuntägiger Reifung bei 4 °C.
Das Ergebnis: Die Mischung eliminierte über 90 % der MRSA-Keime, auch in widerstandsfähigen Biofilmen, gegen die moderne Antibiotika oft machtlos sind.
Im Test gegen MRSA – der Härtetest
Die Kombination wurde bei deren erstmaliger „Entdeckung“ im Labor gegen MRSA getestet – also gleich der Härtetest, wenn es um die Beurteilung einer anti-bakteriellen Wirksamkeit einer Substanz geht. Dann wurden die einzelnen Zutaten, als Wein, Zwiebeln, Knoblauch und Gallensekret getrennt gegen MRSA getestet, zusammen mit einer Kontrolllösung als Referenzpunkt. Das Ergebnis war in der Tat umwerfend. Denn die Kombination eliminierte über 90 Prozent der MRSA, was für die Einzelzutaten nicht beobachtet werden konnte.
Der nächste Schritt, den die Mikrobiologen unternahmen, war noch „bösartiger“. Sie wollten die Rezeptur an Biofilmen, bestehen aus MRSA, austesten. Biofilme sind biophysikalische Schutzeinrichtungen von Bakterien, die sich in so dichten Kolonien zusammentun, dass ein Film entsteht, der keine anderen Substanzen durchlässt, den Austausch unter den Bakterien optimiert und eine optimale Ernährungsgrundlage abgibt. Antibiotika haben hier traditionell das Nachsehen. Selbst wenn sie gegen die Keime effektiv sind, sind sie nicht in der Lage, den Schutzfilm ausreichend tief zu durchdringen und ausreichend viele Keime zu eliminieren.
Aber auch unter diesen verschärft ungünstigen Bedingungen zeigte die Bald´s eye Rezeptur hervorragende Ergebnisse. Aber das waren alles Laboruntersuchungen „im Reagenzglas“. Die Frage ist jetzt, kann man die Wirkung auch unter in vivo Bedingungen wiederholen.
Dazu wurde die Rezeptur in die USA geschickt, um die Wirksamkeit am lebenden Modell = Mäusen zu testen. Ich weiß nicht, warum die Engländer das nicht selbst haben machen können. Vielleicht gibt es keine Mäuse mehr auf den britischen Inseln… Wie dem auch sei, in den USA wurde die Kombination an Wunden von Mäusen erprobt als topische Anwendung. Auch hier zeigte sich, dass MRSA in den Wunden fast vollständig eliminiert wurden. Die komplette Wirkung war schon nach nur 24 Stunden abgeschlossen und zeigte sich im Vergleich zu modernen Antibiotika als signifikant überlegen.
Warum diese spezifische Kombination von Gallensekret, Wein (vom Originalweinberg, der in der alten Beschreibung erwähnt wird), Knoblauch und Zwiebeln, die nach der Herstellung noch 9 Tage bei 4 Grad Celsius gelagert werden muss, wirkt, dafür haben die Wissenschaftler keine Erklärung.
Es handelt sich hier nur zu offensichtlich um eine synergistische Wirkung von Substanzen, die in den Zutaten enthalten sind und durch die Lagerung miteinander in Verbindung gebracht werden.
Und noch ein Newsletter den ich Ihnen empfehlen darf: Mein Heilpflanzen-Newsletter:
Neuere Forschung bestätigt die Wirksamkeit – und zeigt noch mehr [Stand 2025]
Seit der ersten Veröffentlichung dieser erstaunlichen Beobachtung ist einiges passiert. Forscher der University of Warwick und anderer Institute haben die alte Rezeptur („Bald’s Eyesalve“) weiter untersucht – und die Ergebnisse sind beeindruckend.
Im Labor wirkte die Kombination aus Knoblauch, Zwiebel, Wein und Galle nicht nur gegen Staphylococcus aureus (MRSA), sondern auch gegen weitere Problemkeime wie Acinetobacter baumannii und Stenotrophomonas maltophilia. Vor allem bei Biofilmen – also jenen bakteriellen Schutzschichten, gegen die moderne Antibiotika oft machtlos sind – zeigte das Mittel deutliche Erfolge.
Interessanterweise waren die Einzelzutaten für sich kaum wirksam. Erst die Kombination – und die neun Tage währende Reifung – entfalteten den vollen Effekt. Das bestätigt etwas, was die Naturheilkunde seit Jahrhunderten weiß: Wirkung entsteht nicht durch einzelne Moleküle, sondern durch das Zusammenspiel.
Auch toxikologisch waren die Ergebnisse überraschend positiv: In Zellkulturen und Tierversuchen zeigten sich keine schädlichen Nebenwirkungen. Die Forscher sprechen inzwischen offen von einem „potenziellen Vorbild für neue antimikrobielle Therapien“, die sich an alten Naturrezepturen orientieren könnten.
Noch stehen klinische Studien am Menschen aus – aber der Weg ist bereitet. Und er führt nicht in ein neues Labor, sondern zurück zu einer alten Einsicht: „Die Natur hat keine Patente nötig.“
Gegenmaßnahmen der evidenzbasierten Art
Es muss für die Schulmedizin ernüchternd sein, nicht nur vor den antibiotikaresistenten Keimen die Waffen strecken zu müssen, sondern sich jetzt auch noch von einer Medizinrichtung überholen lassen zu müssen, auf die man bestenfalls nur gönnerhaft herabgeblickt hat.
Oder ist es einfach nur deprimierend zu sehen, mit wie wenig Verstand man heute in der Schulmedizin dem Problem der Resistenzentwicklung begegnet. Statt dessen erhalten wir, nachdem man uns alle Hoffnung geraubt und den Weltuntergang prophezeit hat, fast täglich neue Erfolgsmeldungen, denen zufolge es ein neues Antibiotikum gibt, aus dem Reagenzglas, dass mit der Bedrohung fertig zu werden verspricht. Zwei Wochen später redet niemand mehr darüber. Denn man hat bei den Neuen auch schon die ersten Resistenzbildungen gesehen.
Wie wird man von offizieller Seite mit diesem Problem fertig? Das Robert-Koch-Institut zum Beispiel macht seinem störrischen Namensgeber alle Ehre (warum ich den als „störrisch“ bezeichne, können Sie hier nachlesen: http://renegraeber.de/Schulmedizin-Studien-Report.pdf). Denn Resistenzen bekämpft das RKI mit dem Sammeln von Daten:
„Voraussetzung für die Erarbeitung von zentralen Empfehlungen für gezielte Präventionsmaßnahmen und Regime der rationalen Chemotherapie sind verlässliche Surveillance-Daten zum Auftreten und zur Verbreitung der Resistenz und zum Antibiotikaeinsatz. Mit der Zielstellung, eine repräsentative Datenbasis zur Antibiotikaresistenz in Deutschland zu erarbeiten, wurde 2007 das Projekt ARS – Antibiotika-Resistenz-Surveillance in Deutschland ins Leben gerufen. Ausführliche Informationen sowie eine interaktive Datenbank zur Resistenzsituation finden sich auf der Webseite „Antibiotika-Resistenz-Surveillance am RKI“ (siehe unter „Datenquellen“).“ Aus: Antibiotikaresistenz
Ich interpretiere diese Form der Problemlösung als komplette Hilflosigkeit der Resistenzentwicklung gegenüber. Man schaut zu, wie sich das Problem ausweitet und verschärft und führt genau Buch darüber. Toll! Herzlichen Glückwunsch! Im alten England hatte man vor 1000 Jahren die Lösung als Idee und Sud nach nur 9 Tagen zur Hand.
Fazit
Resistenzen sind umgehbar. Die alten Engländer (und die Naturheilkunde) haben uns einen Weg gezeigt, der aber vollkommen uninteressant ist für Leute, die die Resistenzen als Grundlage nehmen, neue verkaufsfähige und -kräftige Antibiotika in die Welt zu setzen.
Und wenn die Neuen dann auch Resistenzen zeigen, dann wird wieder ein noch Neueres dazu entwickelt.
Und damit uns die natürlichen Antibiotika mit ihrer überzeugenden Wirkung nicht in die Quere kommen, müssen Verbote, verschärfte Zulassungsbestimmungen für natürliche Substanzen und so weiter her, die den Markt für Infektionskrankheiten freihalten von bedrohlicher Konkurrenz.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 mit neueren Erkenntnissen ergänzt.
Beitragsbild: 123rf.com – Alfio Scisetti