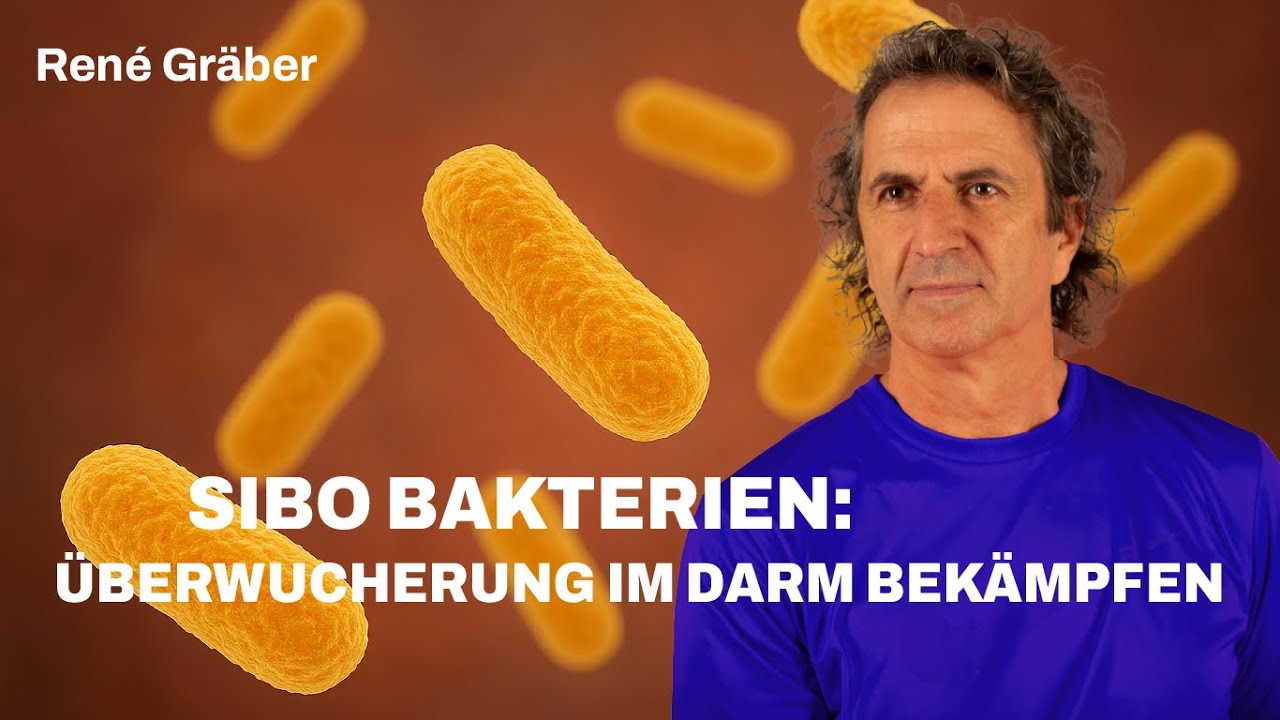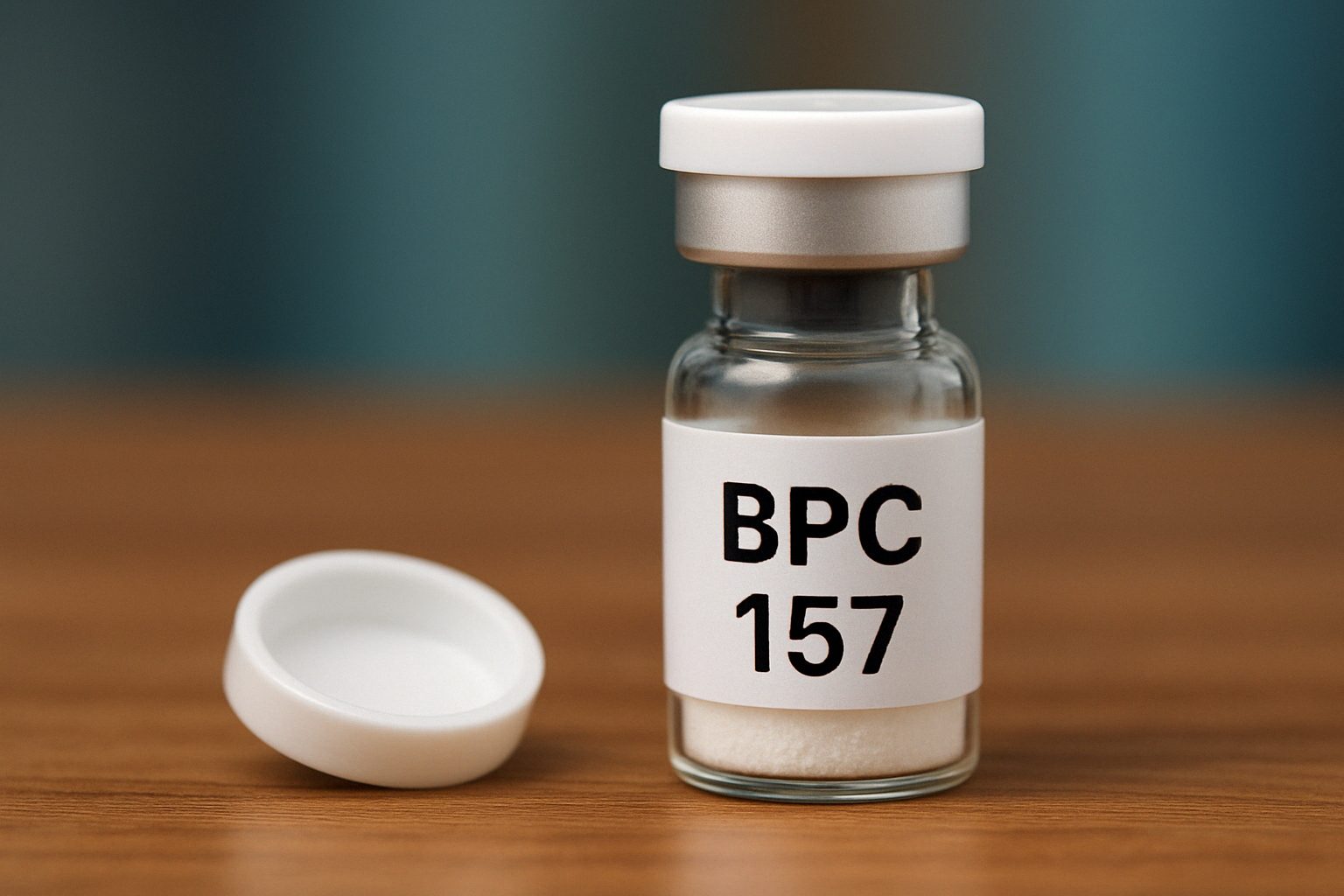Ein Glas in Ehren – so beginnt vieles, was später teuer bezahlt wird. Alkohol gilt noch immer als sozialer Kitt, als Genussmittel, als harmlose Gewohnheit. Gleichzeitig wächst die Zahl der Studien, die nüchtern das Gegenteil zeigen: Schon geringe Mengen Alkohol erhöhen das Krebsrisiko messbar. Nicht irgendwann. Nicht nur bei Missbrauch. Sondern dort, wo viele sich noch auf der sicheren Seite wähnen.
Seit Ende der 1990er Jahre sehe ich in der Praxis, wie regelmäßig „maßvoller Konsum“ und biologische Realität auseinanderklaffen. Die Leberwerte steigen schleichend, das Gehirn verliert Volumen, Entzündungsprozesse werden angefacht – und Krebs ist dabei kein Ausreißer, sondern Teil eines größeren Musters. Der Körper verzeiht viel, aber er vergisst nicht.
Besonders heikel: Niemand weiß im Voraus, ob er zu denjenigen gehört, die Alkohol scheinbar besser vertragen – oder zu denen, bei denen schon kleine Mengen zum Brandbeschleuniger werden. Diese individuelle Anfälligkeit erkennt man erst, wenn der Schaden da ist. Und dann ist es zu spät für Statistik-Tricks und Verharmlosungen.
In diesem Beitrag geht es deshalb nicht um Moral oder Verbote, sondern um Biologie, Zahlen und Konsequenzen. Um aktuelle Daten zum Krebsrisiko, um Leber, Gehirn und Stoffwechsel – und um praktikable Strategien, wie man den eigenen Alkoholkonsum realistisch einordnet und reduziert. Bewegung, gezielte Ernährung, Leberentlastung, Fastenphasen und klare Entscheidungen spielen dabei eine größere Rolle als jede offizielle Trinkempfehlung.
Der Jahreswechsel liefert dafür einen passenden Moment.
Was wissen / wussten wir eigentlich bisher?
Es ist bereits bekannt, dass Alkohol das Risiko für verschiedene Krebsarten erhöht, selbst bei moderatem Konsum. Trotzdem ist Alkoholkonsum weit verbreitet, und es bleiben wichtige Fragen offen, wie die Häufigkeit und Menge des Alkoholkonsums das allgemeine Krebsrisiko beeinflussen. [i]
Aber auch andere gesundheitliche Probleme werden durch Alkoholkonsum in Gang gebracht: [ii] [iii] [iv]
Welche Strategien gibt es, den Alkoholkonsum zu reduzieren? Zum Beispiel dies: [v]
Studie: Sport reduziert das Verlangen nach Alkohol
Aber das alkoholbedingte Krebsrisiko ist nicht gleichmäßig verteilt. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind anfälliger, doch viele Alkoholrichtlinien betonen den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebs immer noch nicht deutlich genug. Und wer weniger anfällig ist, weiß man erst, wenn es zu spät ist und man zu den Anfälligen gehört. Prost…
Im Dezember 2025 wurde eine Studie veröffentlicht, die dieser Frage nach dem Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum nachging. [vi]
Die Studie, der Alkoholkonsum und das Krebsrisiko
Um diese Frage zu beantworten, führten Forscher des „Charles E. Schmidt College of Medicine“ der „Florida Atlantic University“ eine umfassende systematische Übersichtsarbeit durch, um besser zu verstehen, wie unterschiedliche Mengen an Alkoholkonsum – übermäßiger, moderater und auch ein geringer Konsum – das Krebsrisiko bei Erwachsenen in den USA beeinflussen.
Das Team wertete 62 Studien mit Teilnehmerzahlen von 80 bis fast 100 Millionen Personen aus. Die Analyse berücksichtigte auch Begleiterkrankungen wie Fettleibigkeit und chronische Lebererkrankungen, die das Krebsrisiko erhöhen können, und untersuchte, wie soziale und demografische Faktoren zur Anfälligkeit beitragen.
Die in der Fachzeitschrift „Cancer Epidemiology“ veröffentlichten Ergebnisse bestätigen, dass sowohl die Häufigkeit als auch die Menge des Alkoholkonsums eine wichtige Rolle für das Krebsrisiko spielen. Starke Zusammenhänge wurden für Brust-, Darm-, Leber-, Mund-, Kehlkopf-, Speiseröhren- und Magenkrebs festgestellt. Alkoholkonsum war auch mit schlechteren Krankheitsverläufen verbunden, darunter fortgeschrittener Leberkrebs und eine geringere Überlebensrate bei Menschen mit alkoholischer Lebererkrankung.
Wer trägt das höchste Risiko durch Alkoholkonsum?
Ein höherer Alkoholkonsum war mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden, insbesondere bei Afroamerikanern, Menschen mit genetischer Veranlagung und Personen mit Übergewicht oder Diabetes. Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Alter, Bildung und Einkommen beeinflussten das Risiko und die Anfälligkeit zusätzlich. Infolgedessen waren sozioökonomisch schwächere Gruppen sowie einige ethnische Bevölkerungsgruppen überproportional stark betroffen, selbst wenn ihr Alkoholkonsum ähnlich hoch oder niedriger war als der anderer Gruppen.
Im Gegensatz dazu hatten Menschen, die die Richtlinien der „American Cancer Society“ zum Alkoholkonsum und anderen gesunden Lebensstilfaktoren befolgten, tendenziell ein geringeres Krebsrisiko und eine niedrigere Sterblichkeitsrate. Dieses Ergebnis unterstreicht die Bedeutung der Kombination von Mäßigung mit umfassenderen Änderungen des Lebensstils.
Getränkeart, Geschlechtsunterschiede und weitere Risikofaktoren
Die Studie ergab außerdem, dass die Art des alkoholischen Getränks in manchen Fällen eine Rolle spielen kann. So wurde beispielsweise Weißwein oder Bier mit einem höheren Risiko für bestimmte Krebsarten in Verbindung gebracht, während dies bei Spirituosen oft nicht der Fall war. Deutliche Geschlechtsunterschiede zeigten sich ebenfalls. Regelmäßiger Alkoholkonsum war bei Männern mit einem höheren Risiko verbunden, während episodischer starker Alkoholkonsum bei Frauen ein größeres Risiko darstellte. Rauchen erhöhte das alkoholbedingte Krebsrisiko zusätzlich, wobei die Auswirkungen je nach Geschlecht und Trinkgewohnheiten variierten. Weitere Einflussfaktoren waren UV-Strahlung (die das Melanomrisiko an weniger exponierten Stellen erhöht) und die familiäre Vorbelastung, die beide den Zusammenhang zwischen Alkohol und Krebs verstärken können.
Zu den weiteren Risikofaktoren, die in den Studien identifiziert wurden, gehörten ein hoher oder niedriger BMI, geringe körperliche Aktivität, krebserregende Infektionen (z. B. Hepatitis-B- und -C-Virus, HPV, HIV oder Helicobacter pylori, ein Bakterium, das die Magenschleimhaut infiziert), ungesunde Ernährung, Hormonbehandlung und bestimmte Haar- oder Augenfarben.
„Biologisch kann Alkohol die DNA durch Acetaldehyd schädigen, den Hormonspiegel verändern, oxidativen Stress auslösen, das Immunsystem unterdrücken und die Aufnahme von Karzinogenen erhöhen“, sagte Dr. Lewis S. Nelson, Co-Autor, Dekan und Leiter der Gesundheitsabteilung des „Schmidt College of Medicine“. „Diese Effekte werden durch Vorerkrankungen, Lebensstilentscheidungen und genetische Veranlagungen verstärkt, die alle die Krebsentwicklung beschleunigen können.“
Auswirkungen auf Prävention und öffentliche Gesundheit
Basierend auf ihren Ergebnissen weisen die Forscher auf gezielte Ansätze hin, die dazu beitragen könnten, die durch Alkohol bedingte Krebsbelastung zu verringern. Dazu gehören maßgeschneiderte Aufklärungskampagnen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, strengere Alkoholrichtlinien und gezielte Interventionen für besonders gefährdete Personen und Gemeinschaften.
Die Autoren kamen auch zu dem Schluss, dass die Ergebnisse Grund für die Annahme gaben, dass das durch Alkohol bedingte Krebsrisiko nicht allein durch Alkohol verursacht wird, sondern durch ein komplexes Zusammenspiel biologischer, verhaltensbezogener und sozialer Faktoren.
Und hier gibt es ein komplexes „Zusammenspiel“ zwischen Exposition, Anfälligkeit und sich daraus ergebenden gesundheitlichen Konsequenzen. Das macht die Beurteilung der individuellen Anfälligkeit schwierig. Wie ich bereits erwähnte, kann man die eigene Anfälligkeit nur dadurch herausfinden, indem man den Selbstversuch startet. Nur sind die daraus folgenden Ergebnisse mitunter lebensgefährlich. Und damit ist diese Option eben keine Option.
Diese umfassendere Perspektive zeigt zudem, dass wirksame Prävention über die Reduzierung des Alkoholkonsums hinausgeht; sie erfordert die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, Gewohnheiten und zugrunde liegenden Gesundheitszustände, die dessen Auswirkungen verstärken.
Fazit
Alkoholkonsum hat nichts mit einer gesunden Lebensführung zu tun. Auf Alkohol verzichten ist aber auch nicht gleichbedeutend mit „gesund leben“, wenn andere Faktoren zu einem gesunden Leben ignoriert werden, wie gesunde Ernährung, körperliche Bewegung, Stressmanagement, mentale Gesundheit etc.
Fazit vom Fazit: Bringt uns das Glas Sekt zum Jahreswechsel um? Wohl kaum. Denn dann wäre wohl die halbe Menschheit nicht mehr anwesend. Was uns aber umbringen könnte, ist, wenn der Sekt jeden Tag fließt und jeder Tag Jahreswechsel ist. Jeder Tag Jahreswechsel ohne Alkohol dagegen wäre schon wieder ein Schritt in Richtung Gesundheit.
[i] Mehr Krebstote durch Alkohol: US-Zahlen verdoppelt – Deutsche Statistik unklar
(https://www.yamedo.de/blog/alkohol-krebs-todesfalle-statistik/)
[ii] Das „Problem“ Alkohol im Zusammenhang mit den Leberwerten
(https://www.leberwerte-lexikon.de/alkohol-leberwerte/)
[iii] Die Leber und der Alkohol: Leberkrankheiten durch Alkohol
(https://www.gesund-heilfasten.de/leberkrankheiten-durch-alkohol/)
[iv] Alkohol: schon geringe Mengen schaden dem Gehirn
(https://www.yamedo.de/blog/alkohol-schadet-dem-gehirn/)
[v] Studie: Sport reduziert das Verlangen nach Alkohol
(https://www.der-fitnessberater.de/blog/sport-reduziert-verlangen-nach-alkohol/)
[vi] A systematic review on the risk of developing cancer and frequency of alcohol consumption behaviors in US adults – ScienceDirect
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877782125002164?via%3Dihub)